Das Tagungs A-Z
Das A-Z, unser traditioneller Vorfreude-Countdown, begleitet Sie hier ab dem 09.04.2025!
A=Alexandrowka
- A=Alexandrowka

Alexandrowka ist eine charmante Sehenswürdigkeit in Potsdam, die im 19. Jahrhundert erbaut wurde. Diese russische Kolonie wurde auf Anordnung von Friedrich Wilhelm IV. gegründet und erinnert an die enge Verbindung zwischen Preußen und Russland. Die malerischen Holzhäuser im russischen Stil, umgeben von einer idyllischen Landschaft, laden zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Besonders beeindruckend ist die Alexander-Newski-Kirche, die das Herzstück der Anlage bildet. Alexandrowka ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein beliebter Rückzugsort für Besucher, die die kulturelle Vielfalt und die Schönheit der Umgebung genießen möchten.
- A=Alter Markt

Kommt man mit dem Zug nach Potsdam, steht man beim Überqueren der Havel am Geburtsort von Potsdam, dem Alten Markt.
An dieser Stelle des ältesten Potsdamer Brückenschlags über die Havel stand schon im frühen Mittelalter eine steinerne Turmburg. Heute beginnt hier die historische Innenstadt. In den letzten 20 Jahren aufwendig saniert und wieder aufgebaut, wird der Alte Markt heute eingerahmt vom wiedererrichteten Stadtschloss (Sitz des Brandenburger Landtags), dem Alten Rathaus (heute Potsdam Museum), dem Museum Barberini und der altehrwürdigen Nikolaikirche.
Die gewaltige Kuppel der Nikolaikirche prägte einst gemeinsam mit den Türmen von Garnison- und Heilig-Geist-Kirche die Silhouette der Stadt. Von der 57 Meter hohen Aussichtsplattform der Kirche hat man einen wundervollen Rundumblick über die Stadt. Für dieses klassizistische Erscheinungsbild mussten in den letzten Jahren einige sozialistische Gebäude wie die Fachhochschule oder der Staudenhof weichen. Lediglich das Hotel Mercure erinnert noch an die Architektur der DDR.
Dem staunenden Besucher ist das egal. Er schlendert an den klassizistischen Häuserfassaden vorbei zum Holländischen Viertel, von dort über die Brandenburger Straße zum Brandenburger Tor und über den Luisenplatz und die Charlottenstraße wieder zurück zum Ausgangspunkt. Von vielen Einwohnern und Kritikern der neuen Potsdamer Mitte als „preußisches Museum“ bezeichnet, erfreuen sich vor allem die Touristen an dem lebendigen Flair der Stadt mit ihren Geschäften, Cafés und kulturellen Veranstaltungen.
- B=Babelsberg

Babelsberg ist der größte Stadtteil von Potsdam und hat eine reiche und interessante Geschichte. Ursprünglich war Babelsberg ein kleines Dorf (Neuendorf – Nowa Ves), das im 13. Jahrhundert gegründet wurde. Die Lage an der Havel und die Nähe zu Potsdam machten es zu einem attraktiven Ort für Siedler.
Im 19. Jahrhundert erlebte Babelsberg einen bedeutenden Wandel, als es zu einem beliebten Wohnort für wohlhabende Berliner wurde. Dies führte zur Entwicklung prächtiger Villen und Gärten, die den Charakter des Stadtteils auch heute noch prägen. Besonders bekannt ist das Schloss Babelsberg, das 1833 im Auftrag von König Friedrich Wilhelm IV. erbaut wurde und heute ein bedeutendes historisches Bauwerk ist.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Geschichte Babelsbergs ist die Entstehung der Filmindustrie. In den 1920er Jahren wurde hier die UFA (Universum Film AG) gegründet, die zu einem der bedeutendsten Filmstudios in Deutschland wurde. Babelsberg entwickelte sich schnell zu einem Zentrum der Filmproduktion, eine Rolle, die es bis heute innehat. Das Studio Babelsberg ist eines der ältesten Filmstudios der Welt und hat zahlreiche berühmte Filme, wie Metropolis (1927) oder Inglourious Basterds (2009) hervorgebracht.1939 wurde der Ort, nun unter dem Namen Babelsberg, offiziell als Stadtteil von Potsdam eingegliedert.
Heute ist Babelsberg mit seinen rund 25.000 Einwohnern ein lebendiges Viertel, das sowohl historische als auch moderne Elemente vereint. Die Kombination aus Geschichte, Kultur und Natur macht Babelsberg zu einem attraktiven Ort zum Leben und Besuchen.
- B=Barberini

Die große Kunst im alten, neuen Gebäude. Der ursprüngliche Palast Barberini aus dem Jahr 1770, und ja der Palast in Rom stand Pate in Aussehen und Namensgebung, wurde in den letzten Tagen des 2. Weltkrieges zerstört. Leere füllte die Brache bis sich Hasso Plattner den rekonstruierten Neubau stiftete. Grundstock des Kunstmuseums ist die umfangreiche Kunstsammlung des Stifters und Mäzens Hasso Plattner, der seines Zeichens das HPI gegründet hatte. Die Sammlung umfasst hochkarätige Werke des französischen Impressionismus und Kunst der DDR. So schreitet bereits im Innenhof der Jahrhundertschritt von Wolfgang Mattheuer zum Ufer hin. Vier bis fünf Wechselausstellungen im Jahr laden immer wieder zu neuen Entdeckungen ein.
- B=Brigade

1959
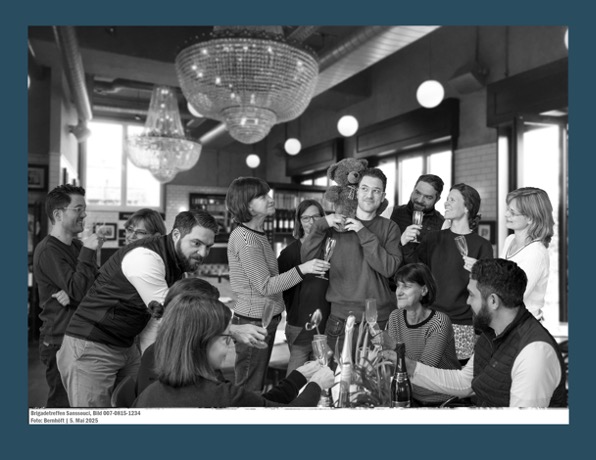
2025
Auch die Revolution braucht ein Organigramm.
Die kleinste Arbeitseinheit innerhalb des realexistierenden Sozialismus war die Brigade, a.k.a. Arbeitsbrigade. Ob in der LPG, PGH oder bei den Pionieren, überall formierten sich die Brigaden. Dass die Brigaden auch im Wettbewerb zueinander standen, dies ausgetragen über die Kombinate, lässt aufgrund der Rahmenbedingung Sozialismus aufhorchen.
Heute sind sie Geschichte, leben aber in vielen Erinnerungen, Medaillen und Gruppenfotos in Schrankwänden und in den Herzen weiter.
- C=Cafés

Um sich von einem anstrengenden Tagungstag zu erholen, findet man in Potsdam zahlreiche hübsche Cafés. Das wohl Traditionellste ist das „Café Heider“, unweit des Nauener Tores. Gern auch als „Wohnzimmer der Stadt“ bezeichnet, lädt das Café in romantischer Inneneinrichtung mit goldgefassten Spiegeln und großen Samtsofas zu einem gemütlichen Kaffeenachmittag mit großer Auswahl an leckeren Kuchen und Torten ein.
Den Kaffeebohnen beim Rösten zusehen und dabei eine Tasse köstlichsten Kaffees genießen – das kann man in der „Havelbohne“ in der Lindenstraße. Klein, aber fein. Zum Kaffee gibt es regionale Leckereien und selbstgebackenen Kuchen. Wem der Kaffee mundet, da kann sich gleich ein Tütchen Lieblingskaffee mit nach Hause nehmen.
In der Allee nach Sanssouci befindet sich das „Café Franz. Schubert“, benannt nach seiner Inhaberin (Franziska). Hier kann man nicht nur selbstgebackenen Kuchen und verschiedene Kaffeevariationen genießen, sondern auch hochwertige Andenken, Ölbilder, Radierungen oder Kupferstiche von Potsdam und seinen königlichen Regenten erwerben.
Wer kein Kaffeetrinker oder Kuchenessen ist, gönnt sich das beste Eis der Stadt bei der EISFRAU. Die kleine Eismanufaktur betreibt mittlerweile zwei Filialen: eine in Babelsberg und eine in Potsdam West. Die Eisfrau ist bekannt für cremiges Eis und fruchtige Sorbets mit intensivem Aroma, aus eigener Herstellung, natürlich und ohne Zusatzstoffe.
- C=Cecilienhof

Nein, wir sind nicht in England, auch wenn es der Tudorstil von Paul Schultze-Naumburg recht nahe legt.
1917 fertiggestellt, wurde es von den Hohenzollern nicht mehr lange bewohnt.
Geschichtsträchtig wurde es noch 1945 durch die Tagung der Potsdamer Konferenz. In neuerer Zeit eher in der Presse um Streitigkeiten mit dem Hause Hohenzollern über Besitzansprüche, die aber beigelegt zu sein scheinen.
Schloss Cecilienhof – Wo Geschichte auf britischen Landhausstil trifft
Wer sich für Geschichte interessiert, kommt an Schloss Cecilienhof nicht vorbei. Hier, in diesem malerischen Backsteinschloss im englischen Landhausstil, wurde 1945 Weltpolitik geschrieben – die Potsdamer Konferenz mit Churchill, Truman und Stalin fand genau hier statt. Heute können Besucher die original erhaltenen Räume besichtigen, inklusive des berühmten runden Verhandlungstischs.
Doch Cecilienhof ist nicht nur für Historienfans spannend: Das Schloss liegt im idyllischen Neuen Garten, direkt am Jungfernsee – perfekt für einen Spaziergang. Wer nach dem Rundgang noch etwas Zeit hat, kann im Café nebenan entspannen oder weiter zur nahen Glienicker Brücke spazieren, die einst Agenten austauschte. Fazit: Ein Muss für alle, die Geschichte hautnah erleben wollen – und nebenbei eine der schönsten Ecken Potsdams genießen möchten.
- D=Deutsches Rundfunkarchiv

Er hat den Farbfilm vergessen?
Dem Deutschen Rundfunkarchiv würde das nicht passieren! Bei Minusgraden lagern hier die Filme des DDR-Fernsehens und bleiben so für die Zukunft gesichert. Welches Programm durch die Fernseher und Radios der DDR (und darüber hinaus bis zum 31. Dezember 1991) flimmerte und funkte lässt sich im DRA nachvollziehen – und selbstverständlich ist Nina Hagen auch dabei! Am 2000 eingeweihten Standort in Potsdam-Babelsberg kommen sämtliche Medienträger und Unterlagen, die zu DDR-Zeiten in den Redaktionen des Fernsehzentrums in Berlin-Adlershof und des Funkhauses in der Nalepastraße produziert wurden, zusammen. Daneben finden sich Zeugnisse früher Tonaufnahmen, sowie Aufzeichnungen der Übertragungen des Hörfunks der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Dieses Erbe deutscher Rundfunkgeschichte aus über 100 Jahren verwaltet das Archiv im Auftrag der ARD als eine ihrer Gemeinschaftseinrichtungen. Die Mitarbeitenden des DRA geben Auskunft über die Bestände, sorgen für ihre Langzeitsicherung und ermöglichen einen rechtssicheren Zugang für Journalisten, Kultur, Wissenschaft und Öffentlichkeit. Ob etwa in der ARD Mediathek oder in Ausstellungen – wo sich mit deutscher Zeitgeschichte beschäftigt wird, trifft man auch die Bestände des DRA.
- E=Einsteinturm

Auf dem Potsdamer Telegrafenberg thront der Einsteinturm – ein Bauwerk, das Wissenschaft und Architektur miteinander verbindet. Entworfen vom Architekten Erich Mendelsohn und gebaut zwischen 1919 und 1924, sollte das Observatorium ursprünglich Einsteins Relativitätstheorie experimentell bestätigen. Auch wenn dieses Vorhaben scheiterte, ist der Turm heute ein Symbol für die Fortschritte in Physik und Architektur der 1920er Jahre. Ob er dabei dem Expressionismus, dem Jugendstil oder der „organisch[en]" Architektur zuzuordnen ist – wie Einstein selbst das Gebäude beschrieb –, bleibt bis heute umstritten. Hinter der ästhetischen Fassade verbirgt sich ein beeindruckendes Sonnenteleskop zur Untersuchung der solaren Magnetfelder, mit dem sich eine 1-Euro-Münze theoretisch noch aus fünf Kilometern Entfernung erkennen ließe – aber auch eine ziemlich marode Baustruktur. Die damals noch unerprobte Mischbauweise aus Stahlbeton und Ziegel führte früh zu Rissen, sodass der Turm mehrfach saniert werden musste, zuletzt 2023. Für die Wissenschaft bleibt der Einsteinturm dennoch von großer Bedeutung. Hier entwickeln Potsdamer Astronomen Instrumente für das Observatorium auf Teneriffa und bilden den wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Zu diesem Zweck ist das Gebäude für Besucher meist verschlossen, doch eine digitale Ausstellung mit 3D-Modell gewährt spannende Einblicke in Geschichte und Funktion des Turms.
Kurios ist das Mini-Bronzehirn, das vor dem Turm im Pflaster versteckt ist, eine Hommage an die menschliche Wahrnehmung. Und wer das Cover des Albums Silent Knight von Saga kennt, wird den Einsteinturm dort wiedererkennen. Wissenschaft, Kunst und Rockmusik – alles an einem Ort!
- E=Einwohner

Potsdam ist eine stetig wachsende Stadt. Lebten 1999, knapp zehn Jahre nach der Wende, nur noch rund 129.000 Menschen in der Landeshauptstadt, waren es 2023 bereits schon wieder 187.300. Laut einer Prognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung wird die Einwohnerzahl bis 2045 – entgegen dem Landestrend – auf rund 210.000 Menschen ansteigen. Eine hohe Lebensqualität durch eine schöne Umgebung und viel Grün, eine Vielzahl an Bildungs- und Forschungseinrichtungen, ein reichhaltiges kulturelles Angebot und eine stetig wachsende Wirtschaft machen Potsdam als Wohnort so beliebt.
Dieser rasante Anstieg bringt aber natürlich auch große Probleme und Herausforderungen mit sich: Wohnungsmangel, Mietenexplosion und eine überlastete Infrastruktur.
Vor allem viele junge Leute, die zum Studieren nach Potsdam kommen, haben das Nachsehen. Nur etwas mehr als ein Zehntel der rund 25.000 Studierenden bekommt einen Wohnheimplatz.
Der Altersdurchschnitt in Potsdam liegt aktuell bei etwa 43 Jahren. Die Stadt hat eine ausgewogene Altersstruktur, die sowohl jüngere als auch ältere Einwohner umfasst. Neben der hohen Zahl an Studierenden ist die Stadt aber auch für viele Familien und ältere Menschen attraktiv.
- F=Filmmuseum

Internationale Film- und Kinogeschichte mit einem Schwerpunkt auf das legendäre Filmstudio Babelsberg findet man im Filmmuseum Potsdam, das zentral unweit vom Hauptbahnhof und gegenüber von Landtag und Altem Markt gelegen ist. Das Filmmuseum ist nicht nur das älteste seiner Art in Deutschland – schon 1981 wurde es als Filmmuseum der DDR gegründet – es befindet sich auch im ältesten erhaltenen Gebäude von Potsdam, dem Marstall von 1685. Ein besonderes Highlight sind die regelmäßigen Stummfilmvorführungen im hauseigenen Kinosaal mit Live-Untermalung auf einer der wenigen weltweit noch intakten Welte-Kinoorgeln von 1929.
Auch sonst bietet das Kino im Filmmuseum ein vielfältiges und stets lohnenswertes Programm, das im monatlichen Programmheft, das überall in der Stadt ausliegt, nachgelesen werden kann.
Neben den Museumsräumen in der Innenstadt, gibt es seit Anfang 2025 ein neues Schaudepot in Potsdam-Babelsberg, für das man individuelle Führungen über die Webseite des Filmmuseums buchen kann.
- F=Freundschaftsinsel

Direkt zwischen Hauptbahnhof Potsdam und Innenstadt liegt die Freundschaftsinsel, die einst als Schwemmsandinsel die Havel in die „Alte" und „Neue Fahrt" teilte.
Heute ist sie ein Ort zum Entspannen und Genießen. Kürzlich wurde sie auch politisch zur Bühne: Bundeskanzler Scholz, der übrigens gleich um die Ecke wohnt, flanierte hier mit Frankreichs Präsident Macron – ein symbolischer Schritt für die deutsch-französische Freundschaft.
Was die Insel neben ihrem Namen so besonders macht, ist der Garten, den der Staudenzüchter Karl Foerster hier in den 1930er-Jahren als Deutschlands ersten Schau- und Sichtungsgarten anlegen ließ. Nach Kriegszerstörungen aufwendig rekonstruiert, begeistern heute wieder ganzjährig Phlox, Rittersporn und Astern. Über 5.000 Schilder liefern Informationen zu den verwendeten Einzelpflanzen, die in einer europaweiten Suchaktion zusammengetragen wurden - perfekt für Wissensdurstige.
Doch auch Nicht-Botaniker kommen auf ihre Kosten: Breite Wege laden zum Flanieren ein, eine Freilichtbühne und ein Ausstellungspavillon bieten regelmäßig kulturelle Veranstaltungen an, und in einem Inselcafé kann man sich anschließend entspannen. Besonders sehenswert sind die zahlreichen Skulpturen namhafter DDR-Künstler, Überbleibsel einer Kunstausstellung, und moderne Werke aus der Bundesgartenschau 2001. Sie verleihen der Insel einen zusätzlichen künstlerischen Touch.
Ein Tipp: Von April bis Oktober kann man täglich am Inselende Boote leihen und die Havel erkunden.
- G=Garnisonsstadt / Garnisonkirche

Im 18. und 19. Jahrhundert war Potsdam ein wichtiger Standort für die preußische Armee. Der als Soldatenkönig bekannte Friedrich Wilhelm I. errichtete viele militärische Anlagen und Kasernen und baute Potsdam zur Garnisonsstadt um. Dies führte zu einem starken Anstieg der Bevölkerung und dem Bau neuer Wohnquartiere. Die militärische Präsenz prägte nicht nur die Stadtarchitektur, sondern auch das gesellschaftliche Leben. So ordnete Friedrich Wilhelm I. den Bau der Garnisonkirche, der Kirche St. Nikolai und der Heilig-Geist-Kirche an, die bis zum 2. Weltkrieg das Stadtbild prägten. Fortan galt Potsdam als „Hort des preußischen Militarismus“.
Einen unrühmlichen Eintrag ins Geschichtsbuch erhielt die Stadt mit dem „Tag von Potsdam“. Am 21. März 1933 diente die Garnisonkirche als Schauplatz für den Schulterschluss zwischen der alten Elite und den Nationalsozialisten und legitimierte damit deren Machtübernahme.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Garnisonkirche stark beschädigt und schließlich 1968 auf Befehl Walter Ulbrichts abgerissen. An gleicher Stelle steht bis heute das Rechenzentrum. Nach der Wende wurden die Rufe nach einem Wiederaufbau der Kirche immer lauter – aber auch die Proteste dagegen. Die Befürworter haben schließlich gewonnen, und so können seit Ostern 2024 der wiedererrichtete Garnisonkirchturm und die Nagelkreuzkapelle besichtigt werden.
Auch heute noch gibt es in Potsdam und Umgebung militärische Einrichtungen wie die Havelland-Kaserne im Potsdamer Ortsteil Eiche oder das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Geltow, südwestlich der Stadt.
- G=Glienicker Brücke

Die Glienicker Brücke, die Potsdam und Berlin über die Havel miteinander verbindet, ist eine der bekanntesten Brücken Deutschlands und hat eine bewegte Geschichte. Ursprünglich 1907 als Stahlkonstruktion erbaut, spielte sie während des Kalten Krieges eine zentrale Rolle. Aufgrund ihrer Lage zwischen Ost- und Westdeutschland wurde die Brücke zum Schauplatz des Austauschs von Agenten zwischen der Sowjetunion und den westlichen Geheimdiensten, was ihr den Beinamen „Brücke der Spione“ einbrachte.
Die Glienicker Brücke war eine bedeutende Grenze zwischen der DDR und West-Berlin und diente zugleich als Symbol für die Teilung und den Zusammenhalt Deutschlands. Heute ist sie ein Denkmal, das Besucher aus aller Welt anzieht, und ein wichtiges Zeugnis der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Brücke verbindet nicht nur geographisch zwei Städte, sondern auch die Erinnerungen an eine geteilte und wiedervereinte Nation.
- H=Hafthorn

Die Potsdamer Innenstadt befindet sich im Wandel.
Fortlaufend schließen Geschäfte rund um die Haupt-Einkaufsmeile Brandenburger Straße und fast immer zieht ein Imbiss oder ein Restaurant ein.
Während die Menschen heute im Internet shoppen, bekommt man sie eben zum Essen nach wie vor gut vor die Tür. Leider sind die vielen Gastronomieangebote in der Potsdamer City oft von eher mittelmäßiger Qualität bei gleichzeitig luxuriösen Preisen.
Inmitten der zunehmend für Touristen auf Hochglanz polierten Stadt Potsdam ist die Kneipe Hafthorn hingegen ein angenehmes Stück Punkrock. Schon seit 1993 bekommt man hier zu gitarrenlastiger Musik gutes Bier und einen soliden Burger zu vernünftigen Preisen. Zum Schutz vor nervigen Touris hat sich das Hafthorn in einem unscheinbaren Innenhof versteckt, der von einem eisernen Drachen bewacht wird und in dem man bei gutem Wetter gemütlich auf Biergarnituren sein Feierabendgetränk genießen kann. Nur ein kleines Schild an der Straße weist auf diese Potsdamer Institution hin.
Innen sitzt man an leicht runtergerocktem Mobiliar äußerst gemütlich, auch wenn es abends im stets vollen Gastraum schon ordentlich laut wird und Unterhaltungen eine gewisse stimmliche Durchsetzungskraft erfordern.- H=Hasso-Plattner-Institut

Ja, es geht wieder um Bildung. Um Digital Engineering um genau zu sein. Namensgeber ist der SAP-Gründer Hasso Plattner, der schon weitere Spuren in Potsdam hinterlassen hat (s. Barberini und Minsk). Ein Standort und eine Einrichtung mit Ruf und in steter Weiterentwicklung.
Hasso-Plattner-Institut – Wo die digitale Zukunft entsteht
Potsdam ist nicht nur Barock und Schlösser – sondern auch Hightech! Das Hasso-Plattner-Institut (HPI), benannt nach dem SAP-Mitgründer, ist ein Hotspot für IT-Entwicklung, Künstliche Intelligenz und Innovation. Wer denkt, Informatik sei trocken, wird hier eines Besseren belehrt: Das Institut bietet regelmäßig spannende Vorträge, Workshops und sogar öffentliche Veranstaltungen zu Themen wie Cybersecurity oder Zukunftstechnologien an.
Ein besonderes Highlight ist das Design Thinking Innovation Lab, wo kreative Lösungen für komplexe Probleme entstehen – manchmal in Kooperation mit globalen Unternehmen. Wer sich für Digitalisierung interessiert, sollte unbedingt einen Blick auf die aktuelle Veranstaltungsagenda werfen. Und falls nicht: Direkt nebenan liegt der wunderschöne Campus Griebnitzsee mit Spazierwegen entlang der ehemaligen DDR-Grenze. Ein Besuch lohnt sich also doppelt.
- H=Holländisches Viertel

Holland in Preußen?
Das ist der engen Verbundenheit und Vorliebe von Friedrich Wilhelm I. für den westlichen Nachbarn, der für ihn Inbegriff von Fortschritt war. Zwar kamen die angeworbenen holländischen Handwerker nicht in Scharen, die Häuser blieben und sorgen noch heute, restauriert, für Staunen und einen holländischen Flair in Potsdam.
Das Holländische Viertel– Ein Hauch Amsterdam mitten in Potsdam
Wer durch das Holländische Viertel schlendert, könnte kurz vergessen, dass er in Deutschland ist. Die typisch roten Backsteinhäuser mit weißen Fensterläden und geschwungenen Giebeln wirken wie aus Amsterdam importiert – was historisch gar nicht so falsch ist. Friedrich Wilhelm I. ließ die Siedlung im 18. Jahrhundert für niederländische Handwerker bauen. Heute ist das Viertel ein echtes Szeneviertel mit kleinen Läden, gemütlichen Cafés und Kunstgalerien.
Besonders charmant ist das Viertel im Frühling und Sommer, wenn die Außengastronomie boomt und sich die Straßen mit Leben füllen. Wer eine Pause braucht, kann im legendären Café Guam einen der besten Käsekuchen der Stadt probieren oder sich in einer der vielen kleinen Boutiquen nach handgemachten Souvenirs umsehen. Kurzum: Ein perfekter Ort zum Bummeln, Genießen und das etwas andere Potsdam erleben!
- I=Information-Secialist

Information-Specialist, Dipl.-Dokumentar/Archivar, Informationswissenschaftler, Wissenschaftlicher Dokumentar, Informations- und Datenmanager – egal, wie der Titel am Ende heißt, ausgebildet wurde und wird ein Großteil von ihnen an der Fachhochschule Potsdam.
Seit 1992 erlernten im Gebäude des ehemaligen Instituts für Lehrerbildung am Alten Markt junge Menschen das Sammeln, Sichern, Dokumentieren, Aufbereiten und gezielte Wiederfinden von Informationen und Daten. Aufgrund der Asbestverbauung und des geplanten Wiederaufbaus des Stadtschlosses an alter Stelle musste das Gebäude weichen. Im Herbst 2017 begann der Abriss des Gebäudes, die letzten Studierenden zogen an den FH-Campus an der Pappelallee.
Ebenfalls am Alten Markt ausgebildet wurden seit 1996 viele tausende Wissenschaftliche Dokumentare in ein- oder zweijährigen Lehrgängen bzw. Volontariaten am Institut für Information und Dokumentation (IID). 2016 übernahm die Hochschule Darmstadt das Volontariat zum Wiss.-Dok.
Heute findet man Potsdamer Absolventinnen und Absolventen in den Medienarchiven des öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunks, der gedruckten Presse und bei Verlagen – und wahrscheinlich auch zahlreich bei der Frühjahrstagung des vfm in Potsdam.
- I= Institut für Klimafolgenforschung

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) e.V. ist ein 1992 gegründetes wissenschaftliches Forschungsinstitut und als eingetragener Verein organisiert. Es untersucht wissenschaftlich und gesellschaftlich bedeutsame Fragestellungen in den Bereichen Klimawandel, globale Erwärmung und nachhaltige Entwicklung. ForscherInnen aus den Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften arbeiten hier interdisziplinär zusammen, um Erkenntnisse zu gewinnen, welche als Grundlage für Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dienen können. Das Institut beschäftigt sich mit vier großen Forschungsbereichen: Erdsystemanalyse, Klimaresilienz, Transformationspfade und Komplexitätsforschung.
Gründungsdirektor des PIK war der Physiker aus den Medien sehr bekannte Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, der das Institut bis September 2018 leitete.
2022 war das PIK zum fünften Mal in Folge, laut dem Highly-Cited-Researchers-Ranking der Wissenschaftsplattform „Clarivate“, mit über zehn Forscherinnen und Forschern unter dem obersten Prozent der meistzitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit.
- J=Jägertor

Das Jägertor von 1733 ist das älteste erhaltene Stadttor Potsdams. Es steht in der Achse der Lindenstraße und markiert einen der Stadtausgänge nach Norden. Seinen Namen verdankt es dem vor der Stadt liegenden kurfürstlichen Jägerhof. Das Tor war ursprünglich Teil der Potsdamer Akzisemauer, die nicht der Befestigung diente, sondern die Desertion der Soldaten und den Warenschmuggel verhindern sollte. Da die Lindenstraße den einstigen Mauerzug schräg durchschnitt, wurde auch das Jägertor schräg zum Mauerverlauf errichtet.
Das Tor ist Teil der Promenade, die dem Verlauf der ehemaligen Stadtmauer folgt. Im Stadtgrundriss ist der Unterschied zwischen der kompakten Struktur der zweiten barocken Stadterweiterung südlich und der lockeren Villenbebauung nördlich des Jägertores deutlich erkennbar. Seine Funktion als reizvoller Blickpunkt der Lindenstraße ist nach wie vor gegeben. Zahlreiche Restaurants und viele kleine Geschäfte in der Lindenstraße laden zum Bummeln ein.
- K=Karl Foerster Garten

Gartenpoesie im modernen Senkgarten. Der berühmte Staudenzüchter Karl Foerster lies 1910 in Potsdam-Bornim ein privates Wohnhaus samt Garten errichten, der ihm als praktischer Anschauungsgarten diente: ein begehbarer Katalog, wenn man so will. Seit 1981 unter Denkmalschutz gestellt, bewahrt das Ensemble aus Haus und Garten ein gartenhistorisches Juwel, was auch die royalen weißen Tauben zu schätzen wissen. Der moderne Senkgarten, rübergeschwappt aus dem Garten-Mekka Großbritannien, der durchblüht samt der Villa im englischen Landhausstil.
Let`s get around!
- K=Krongut Bornstedt

Das italienische Dorf in Preußen - so wird das Krongut in Bornstedt auch genannt.
Es war der einstige Sommersitz der Preußischen Königsfamilie. Hier auf Krongut Bornstedt – erbaut im italienischen Stil und malerisch gelegen am Bornstedter See – lebte und wirkte einst das Kronprinzenpaar Friedrich Wilhelm IV. und seine englische Gemahlin Kronprinzessin Victoria. Sie waren es auch, die als maßgebliche Gestalter des Areals – hin zu einem preußischen Mustergut und ländlichem Pendant zu Sanssouci – moderne Einflüsse ihrer Zeit verwirklichten. Auch namhafte Persönlichkeiten wie die königlichen Gartengestalter Lenné und Sello haben hier ihre Handschrift hinterlassen.
Auf den Spuren der wechselvollen Geschichte des Kronguts mit seiner engen Verbindung zum königlichen Sanssouci – nur wenige Gehminuten entfernt, bietet sich ein wunderschönes denkmalmalgeschützte Areal. Es ist heute Teil der UNESCO-Weltkulturerbestätten und fügt sich ein in das Ensemble der berühmten Schlösser und Gärten von Potsdam.
Ein Besuch lohnt sich auch im Rahmen verschiedener Gutsveranstaltungen, die hier über das Jahr stattfinden wie Konzerte, Hoffeste, Märkte und Kulinarische Events .- L=Landeshauptstadt

Potsdam – Mehr als nur Berlins schöne kleine Schwester
Potsdam, das klingt nach preußischem Glanz, nach Sanssouci, nach Parklandschaften und UNESCO-Welterbe. Doch die Landeshauptstadt Brandenburgs ist weit mehr als nur ein barockes Postkartenmotiv. Hier treffen Geschichte und Moderne auf eine Weise zusammen, die überrascht: Neben königlichen Schlössern gibt es innovative Forschungsinstitute, hippe Viertel und eine quirlige Kulturszene.
Die Stadt ist kompakt, grün und unglaublich vielseitig. Vormittags ein Spaziergang durch das Holländische Viertel, nachmittags Hightech-Luft am Hasso-Plattner-Institut schnuppern und abends ein Drink mit Blick auf die Havel – all das geht in Potsdam an einem Tag. Und wer denkt, dass hier nur die Vergangenheit regiert, sollte sich die pulsierende Kneipen- und Kreativszene in der Brandenburger Straße nicht entgehen lassen.
Kurz gesagt: Potsdam ist klassisch und cool zugleich – und immer eine Reise wert!
- L=Lenné, Peter Joseph

Beim Thema Preußische Gartenkunst kommt man nicht an Peter Joseph Lenné vorbei!
Ein halbes Jahrhundert hat er die Gartenkunst in Preußen geprägt, was sich noch heute in Form von Sichtachsen und der anspruchsvollen Bepflanzung auf der Pfaueninsel oder im Park Babelsberg bestaunen lässt. Was freilich nur eine Auswahl darstellt. Zeitlebens blieb er seiner rheinländischen Heimat verbunden, weswegen man auch dort seiner Schaffenskraft fündig wird.
- M=Medienstadt (Babelsberg mit Filmstudios)

Medienstadt heißt nicht nur ein Bahnhof in Babelsberg und das angrenzende Viertel mit Filmstudios und RBB-Gelände, sondern Potsdam ist darüber hinaus ein attraktiver Film- und Medienstandort.
Bereits 1911 erkannte der Filmpionier Guido Seeber die Vorzüge des Ortes und wählte Potsdam-Babelsberg als den perfekten Standort für ein neuartiges gläsernes Filmstudio. Mehr als 100 Jahre später gehört Potsdam immer noch zu den Top-Adressen im internationalen Film- und Fernsehgeschäft. In der Babelsberger Medienstadt haben sich rund 200 Unternehmen und Start-ups angesiedelt. Bekannte Namen sind u.a. die traditionsreiche Filmproduktionsfirma UFA, der Media Tech Hub Potsdam, der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seinen Radiowellen Antenne Brandenburg, Fritz und Radio Eins und das Deutsche Rundfunkarchiv. Auch die altehrwürdige Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und das Medienboard Berlin-Brandenburg, ein Filmförderungsunternehmen der Länder Berlin und Brandenburg, sind ebenfalls in Babelsberg ansässig.
Neben den genannten öffentlich-rechtlichen RFA findet man auch den Privatradiosender BB Radio und den Kindersender Radio Teddy in Potsdam sowie den Lokalradiosender Radio Potsdam.
Auch die Presse ist in Potsdam vertreten: Die Märkische Allgemeine (MAZ) wird als unabhängige Tageszeitung von der Märkischen Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH in Potsdam herausgegeben.
- M=Das Minsk

Die kleine Schwester des Barberini.
Hier aber keine Rekonstruktion, sondern Neubespielung einer Architektur der Nachkriegsmoderne in der DDR. Karl-Heinz Birkholz entwarf das 1977 fertiggestellte Restaurantgebäude am Nordhang des Brauhausbergs. Der Kreis zum Name Minsk schließt sich aus dem ursprünglichen Zweck des Gebäudes: Dort wurde belarussische Küche serviert. Minsk und Potsdam waren seinerzeit Partnerstädte (in Minsk eröffnete vice versa das Restaurant Potsdam). In den Nachwendejahren stand das Gebäude häufig zur Disposition, bis sich schlussendlich Hasso Plattner seiner annahm und es seitdem als Museum betreibt.
- N=Neuer Garten

Zwischen Heiligem See und Jungfernsee erstreckt sich der Neue Garten, den Friedrich Wilhelm II. ab 1787 als modernen Gegenentwurf zum barocken Sanssouci seines Onkels Friedrich des Großen anlegen ließ. Der neue König suchte das Moderne – und modern bedeutete damals englisch. Inspiriert vom englischen Landschaftsgarten in Wörlitz beauftragte er den Sohn des dortigen Hofgärtners mit der Planung eines Parks, der ihm Raum für Ruhe und Träumerei bieten sollte. Noch heute, heißt es, wandele die Seele Friedrich Wilhelms, der zu Lebzeiten an die Existenz des Übersinnlichen glaubte, durch seinen geliebten Neuen Garten, in dem Obstbäume, Windmühlen und bunte Häuser mit roten und grünen Fassaden die idyllische Gestaltung unterstrichen.
Viele der ursprünglichen Bauten sind noch heute erhalten, darunter das Marmorpalais, die in Form einer römischen Ruine gestaltete Schlossküche, die Gotische Bibliothek, eine Orangerie, eine Grotte, eine Meierei, die Pyramide (Eiskeller) und das holländische Etablissement.
1816 überarbeitete Peter Joseph Lenné den bis dahin verwilderten Park und schuf weite Sichtachsen zu den benachbarten Gärten von Sacrow, Glienicke, Babelsberg und der Pfaueninsel.
Geschichtsträchtig ist das Schloss Cecilienhof, das 1917 für Kronprinz Wilhelm im Stil eines englischen Landhauses im Neuen Garten erbaut wurde. 1945 tagten hier die Siegermächte der Potsdamer Konferenz, um über die Neuordnung Europas zu verhandeln.
Übrigens: Passend zum Sprichwort „Schief ist englisch, und englisch ist modern“ ließ ein Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg das Fundament der Gotischen Bibliothek absinken, sodass sie seither als „Schiefer Turm von Potsdam“ bekannt ist. Heute dient sie daher vor allem als Filmkulisse und romantischer Treffpunkt am Heiligen See.
- N=Neues Palais

Das Neue Palais in Potsdam, ein prachtvolles Schloss im Park Sanssouci, wurde zwischen 1763 und 1769 unter König Friedrich II. von Preußen erbaut. Es gilt als eines der bedeutendsten Beispiele des preußischen Rokoko und als Ausdruck von Friedrichs Macht und Reichtum. Errichtet am Ende des Siebenjährigen Krieges, sollte das Neue Palais die ungebrochene Stärke Preußens demonstrieren.
Mit seiner beeindruckenden Fassade aus rotem Sandstein, opulenten Kuppeln und rund 200 prachtvoll ausgestatteten Räumen diente das Schloss vor allem repräsentativen Zwecken. Es war Schauplatz für Bälle, Bankette und Empfänge des Hofes. Besonders bekannt sind der Grottensaal mit seinen Muscheldekorationen und der Marmorsaal, der oft für festliche Anlässe genutzt wurde.
Heute gehört das Neue Palais zum UNESCO-Weltkulturerbe und zieht jährlich zahlreiche Besucher an, die die prunkvolle Architektur und die Geschichte des preußischen Königshauses bewundern möchten.
- N=Nikolaikirche (hier mit echter Turmbesteigung!!!)
Mit Karl Friedrich Schinkel aufs Dach steigen?
Das kann man in Potsdam machen!
Wenn man sich der kleinen sportlichen Herausforderung von 223 Stufen stellt, erreicht man je nach individueller Fitness den äußeren Kuppelrundgang der markant ins Stadtbild ragenden Tambourkuppel der Nikolaikirche. Dort wird man mit einer phänomenalen Aussicht belohnt. Als Hintergrundwissen darf man sich merken, dass die Pläne von Schinkel bis 1850 erst von Ludwig Persius und später dann unter der Bauleitung von Friedrich August Stüler umgesetzt wurden.
Und wer schon genug Sport gemacht hat, kann sich zurücklehnen und sich das Video zu Gemüte führen.
- O=Olympiastützpunkt

Wusstet ihr, dass Potsdamer Sportler schon die eine oder andere Olympiamedaille bei Olympischen Winterspielen geholt haben?
Auch wenn es hier weit und breit keine Berge gibt und Schnee auch eher selten ist, wird am Potsdamer Olympiastützpunkt ein wichtiger Grundstein für den olympischen Wintersport gelegt. Denn hier ist die sogenannte „Potsdamer Anschieberschule“ zuhause, die – wie viele andere Sportler – am Standort Potsdam des Olympiastützpunkts Brandenburg trainiert.
Bei der Bob-WM 2024 gewannen Potsdamer Bobsportler ganze sechs Medaillen. Zur Ausbildung gibt es auf dem weitläufigen Sportgelände am alten Luftschiffhafen im Potsdamer Westen eine eigene Anschubbahn, das Wintertraining findet dann aber doch oft im thüringischen Oberhof statt. Bekanntester Bobsportler ist wohl der gebürtige Potsdamer und viermalige Olympiasieger Kevin Kuske, der – wie viele Anschieber – als Leichtathlet begann.
Bekannt ist der Potsdamer Olympiastützpunkt natürlich auch für seine Ruderer – kein Wunder, liegt das Gelände doch direkt am Templiner See. Die Seenlandschaft der Havel rund um Potsdam ist ein ideales Trainingsrevier für Höchstleistung auf dem Wasser. So trainiert hier Mattes Schönherr, aktuell Teil des berühmten Deutschlandachters, mit dem er u.a. 2024 Europameisterschafts-Zweiter wurde. Maren Völz wurde mit dem Doppelvierer bei Olympia 2024 in Paris Vierte.
Max Lemke und Jacob Schopf holten in Paris Gold im Kajak.
Die bis heute bekannteste Wassersportlerin aus der Potsdamer Talentschmiede ist aber bis heute die achtmalige Olympiasiegerin im Kajak, Birgit Fischer.
In der Leichtathletik gehört Diskuswerferin Kristin Prudenz zu den erfolgreichsten aktuellen Athletinnen – sie holte 2021 Silber bei Olympia in Tokio.
Wir könnten noch ewig so weiterschreiben über Potsdamer Sport-Erfolgsgeschichten, aber das würde hier den Rahmen sprengen…
- O=L'Osteria

Italienisches Flair mit einem kleinen Hauch von Systemgastronomie, sei es drum: die Pizzen sind grande, die Pasta al dente und der espresso buono!
Überzeugt euch selbst am Brigade-Abend!
- P=Preußische Könige

Welcher Friedrich war nochmal der Fritz?
Und welcher Wilhelm war der Soldatenkönig und wo haben sie mit wem gewohnt, gejagt und regiert?
Eine kleine Orientierung soll hier gegeben werden:
- 1701 ging es los mit der Selbst-Krönung von Kurfürst Friedrich III. zum König Friedrich I. in Preußen in Königsberg (erste später hieß es dann von Preußen).
- 1713 folgte dann Friedrich Wilhelm I., langläufig bekannt als der Soldatenkönig.
- Sein Sohn war dann der Große: Friedrich II., der deutliche, noch heute bauhistorische Spuren in Berlin und Brandenburg hinterlassen hat.
- Danach folgte 1786 Friedrich Wilhelm II.,
- 1797 Friedrich Wilhelm III. und dann
- 1840 Friedrich Wilhelm IV., der Romantiker auf dem Thron.
- Ab 1861 Wilhelm I., der dann ab 1871 dann erster deutscher Kaiser wurde...und der Rest ist Geschichte.
- P=Prominente

Seit jeher ist Potsdam bekannt für eine hohe Promidichte. Früher residierten Filmgrößen wie Heinz Rühmann, Marlene Dietrich oder Hans Albers in der Filmstadt Babelsberg.
Heute sieht man Schauspieler Jörg Hartmann über den Familientrödelmarkt in Babelsberg schlendern, tanzt zu aktueller Mucke von Filmregisseur Andreas Dresen beim Promi-DJ-Battle von „Potsdam tanzt“ oder trifft Eiskunstlaufstar Katarina Witt in ihrem Potsdamer Fitnessstudio KURVENSTAR. Aber auch Prominente aus dem Bereich Politik, Forschung und
Wirtschaft sind dem Charme der Havelstadt erlegen. So leben hier nicht nur Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz und die ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock, sondern auch Kai Diekmann, Matthias Platzeck, Friede Springer und Mathias Döpfner.
Doch der wohl berühmteste Potsdamer ist wohl Günther Jauch. Der gebürtige Münsteraner wohnt in einer Villa am Heiligen See und hat sich immer wieder finanziell um den Wiederaufbau und die Restaurierung Potsdamer Kulturstätten verdient gemacht. Jauch hielt auch die Laudatio zur Ehrenbürgerschaft eines anderen Wahlpotsdamers: den SAP-Mitbegründer und Kunstmäzen Hasso Plattner, dessen üppige Kunstsammlung man seit einigen Jahren im Museum Barberini bestaunen kann.
Zu Ehren der vielen in Potsdam bzw. Babelsberg entstanden Filme verwandelt sich die Brandenburger Straße in der Innenstadt derzeit in einen Boulevard des Films. Angelehnt an den berühmten Walk of Fame werden in Potsdam die Namen von erfolgreichen und hier gedrehten Filmen zu lesen sein.
- Q=Quentin-Tarantino-Straße

Zwischen der Joe-May-Straße und der G.-W.-Pabst-Straße (beides bekannte österreichische Regisseure) befindet sich auf dem Filmstudiogelände die Quentin-Tarantino-Straße – benannt, natürlich, nach dem erfolgreichen US-amerikanischen Filmregisseur. Tarantino war die erste lebende Person, nach der auf dem Studiogelände eine Straße benannt wurde. Diese Ehre wurde ihm zuteil, nachdem er rund die Hälfte seines Kinofilms "Inglourious Basterds" auf dem Babelsberger Filmgelände gedreht hatte. An der etwa 100 Meter langen Straße liegen der Eingang zum fx.Center und ein Parkhaus.
- R=rbb

Aus ORB und SFB wird rbb.
Das B als gemeinsamer Nenner sozusagen, was auch nicht schwer ist bei zwei Bundesländern, die mit B anfangen. Seit 2003 aus der Fusion eben dieser beiden entstanden, ist es die Landesrundfunkanstalt der ARD für die Region Berlin und Brandenburg. Fleißig liefert er auch in das Programm der ARD zu: Tatort und Polizeiruf 110 sind die bekanntesten Produktionen. Aber auch bekannte Persönlichkeiten kamen mit und durch den rbb groß wie Kurt Krömer oder Jörg Tadeusz. In Potsdam befindet sich der größte Standort mit 30.000 m2 Grundfläche in der Medienstadt Babelsberg, also in guter Mediengesellschaft. Viele weitere Gewerke wie ARD Digital oder das ARD Play-Out-Center sind dort auch ansässig. Aktuell leider sehr krisengeschüttelt und sich am konsolidieren. Die Zukunft bleibt spannend.
- R=Rechenzentrum

Freiraum für Künstler im ehemaligen DDR-Rechenzentrum. Bedroht durch Wiederaufbaupläne der Garnisonkirche.
Das Rechenzentrum in Potsdam ist ein markantes Bauwerk aus der DDR-Zeit und ein bedeutendes Zeugnis der Architektur und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es wurde 1971 eröffnet und diente ursprünglich als zentraler Standort für die elektronische Datenverarbeitung in der DDR. Der Bau besticht durch seine funktionale Gestaltung im Stil des Brutalismus und das prägnante Glasmosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ von Fritz Eisel, das die Fassade schmückt und den Fortschrittsglauben der damaligen Zeit widerspiegelt.
Nach der Wiedervereinigung verlor das Rechenzentrum seine ursprüngliche Funktion, entwickelte sich jedoch zu einem kreativen Zentrum. Seit 2015 bietet es Ateliers, Werkstätten und Arbeitsräume für Künstler, Kreative und Start-ups. Damit wurde es zu einem wichtigen Ort für die Potsdamer Kulturszene.
Das Rechenzentrum steht in einem Spannungsfeld zwischen Bewahrung und Veränderung, da es an die DDR-Vergangenheit erinnert, zugleich aber ein lebendiges Beispiel für den Wandel und die kreative Nutzung historischer Gebäude ist.
- S=Schiffbauergasse

Internationales Kunst- und Kulturquartier: ob Kunstraum oder das spektakuläre Hans Otto Theater, Abenteuerspielplatz oder Sitz vom Trollwerk: auf 9,4 ha der Halbinsel am Tiefen See ist die geballte Kreativität beheimatet. Einst wurden hier Dampfschiffe gebaut, später waren hier Kasernen zu finden und hier wurde bis zur Wende Gas produziert. Nun säumen Neubauten wie auch denkmalgeschützte Gebäude den Kultur- und Gewerbestandort. Am Schillerndsten ragen heute die roten Dachschalen des Hans Otto Theater nach Entwürfen von Gottfried Böhm an der Uferpromenade hervor.
- S=Sichtachsen

Sichtbeziehungen. Blicke, die von A nach B verlaufen und das Auge mit einem markanten Ziel belohnen. Von diesen historischen Sichtachsen gibt es viele in Potsdam.
Friedrich der Große wollte Potsdam auch vom Stadtbild her endgültig zu einer Residenzstadt machen und veranlasste massive Umbauten an Straßen und Plätzen. Zudem benötigte der König eine funktionierende Infrastruktur in der Stadt. Türmchen, bestimmte Fassaden, Bäume, Brunnen und Berge sollten den Bürgern als Orientierungspunkte dienen.
Die wohl bekannteste Sichtachse führt vom Brandenburger Tor über die Brandenburger Straße bis zur Kirche St. Peter und Paul. Auch den späteren Park Sanssouci ließ Friedrich II. umgestalten. So kann man heute vom Neuen Palais zum Brunnen am Fuße des Schlosses Sanssouci schauen – oder auch vom Ehrenhof des Schlosses hinauf zum Ruinenberg.
Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, entdeckt sicher weitere Bauwerke, Straßen und Plätze, die durch ihre durchdachte Anordnung harmonisch zueinander in Beziehung stehen
- T=Tatra-Tram

Zwar nennen sich die Potsdamer Verkehrsbetriebe selbstbewusst “ViP” (Verkehrsbetrieb in Potsdam), auf den Schienen der Stadt kommt trotzdem noch regelmäßig Technik aus DDR-Zeiten zum Einsatz. Die Tatra KT4D-Straßenbahnen sind in Potsdam seit 1975 im unermüdlichen Linienbetrieb durch die Stadt unterwegs. Der erste Prototyp gehört heute zur historischen Fahrzeugsammlung der ViP, während seine Geschwister zuletzt 2016 und 2017 eine Frischzellenkur bei ihrem tschechischen Hersteller bekommen haben.
Doch trotzdem ist das Fahrgefühl mit so einem Oldtimer immer noch ein anderes als mit den modernen Niederflurwagen. Nicht nur, dass man einige steile Stufen zum Fahrgastraum erklimmen muss (Barrierefreiheit? Fehlanzeige!), es ruckelt auch ganz schön auf den Schienen – und auf den kleinen, schlecht gepolsterten Sitzen ist es auch nicht wirklich bequem.
Eisenbahn-Nostalgiker werden sich aber noch ein paar Jahre regelmäßig an den alten Bahnen erfreuen, auch wenn sie bei Weitem nicht mehr im Originalzustand sind. So wurden sie in der Zwischenzeit umlackiert und bekamen auch innen zumindest eine leicht modernisierte Ausstattung. Waren sie früher rot-weiß, so sind sie heute grün-weiß. Trotzdem ist es ein besonderes Erlebnis mit ihnen unterwegs zu sein.
- T=Tomasa

Tomasa – Genuss zwischen Backstein und Biergarten
Ob Frühstück, Lunch oder Abendessen – das Tomasa ist eine der besten Adressen in Potsdam für Genießer. Das Restaurant befindet sich in einer wunderschönen alten Villa im Babelsberger Park und bietet eine entspannte Mischung aus stilvollem Ambiente und gemütlicher Gastlichkeit. Im Sommer lockt der große Biergarten mit schattigen Plätzen unter alten Bäumen, im Winter sorgt die historische Backsteinarchitektur für eine besondere Atmosphäre.
Die Speisekarte? Vielseitig und lecker. Von deftigen Steaks über frische Salate bis hin zu vegetarischen Gerichten – hier findet jeder etwas. Besonders beliebt ist das ausgiebige Frühstücksangebot, das bis in den Nachmittag hinein serviert wird. Perfekt für alle, die den Tag entspannt beginnen wollen.
Tipp: Nach dem Essen unbedingt einen Verdauungsspaziergang durch den Babelsberger Park machen. Die Havel, die berühmte Glienicker Brücke und das märchenhafte Schloss Babelsberg sind nur wenige Minuten entfernt. Ein Ort zum Wohlfühlen – und zum Wiederkommen!
- T=Turbine Potsdam

Seit 1999 ein eigenständiger Verein, aber schon seit 1971 eine eigene Sparte für Frauenfußball innerhalb der BSG Turbine Potsdam. Viele Erfolge sind zu verzeichnen und konsequentes Eintreten für den Frauenfußball. Aktuell leider in einer sportlich nicht so ganz erfolgreichen Phase. Zwar wieder aufgestiegen in die 1. Bundesliga der Frauen, aber bislang nur mit einem Punkt auf dem Zähler, der Wiederabstieg naht bedenklich.
Und nun ist es amtlich: Seit dem 25. April 2025 steht Turbine Potsdam endgültig als Absteiger fest.
- U=UNESCO-Weltkulturerbe

UNESCO-Weltkulturerbe hautnah erleben
Potsdam ist eine Stadt der Schönheit und Geschichte – ein Ort, an dem sich der preußische Glanz, kunstvolle Gärten und eindrucksvolle Architektur verbinden. Aus diesem Grund wurden die Schlösser und Parks von Potsdam im Jahr 1990 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt.
Das berühmteste Wahrzeichen der Stadt ist Schloss Sanssouci, die ehemalige Sommerresidenz der Könige von Preußen. Auf der Anhöhe der Weinbergterrassen 1745-1747 erbaut, verkörpert das Rokokoschloss das Streben des Königs Friedrich II. nach einem Leben "ohne Sorgen“. Die prachtvollen Räume wie Konzertzimmer, Schlossbibliothek und Konzertsaal beeindrucken mit kunstvoller Ausstattung, während die weitläufige Gartenanlage mit ihren Fontänen, Alleen und Skulpturen zum Spazieren einlädt.
Am westlichen Ende des Parks Sanssouci steht das Neue Palais, das größte Schloss Potsdams. Erbaut als Zeichen preußischer Macht, beeindruckt es mit seinen imposanten Kuppeln, dem Schlosstheater im Rokoko-Stil und den Grotte-Sälen mit funkelnden Muscheldekorationen.
Mit Blick auf die Glienicker Brücke erhebt sich das neugotische Schloss Babelsberg, ehemalige Sommerresidenz von Kaiser Wilhelm I. Umgeben von einem Landschaftspark, gestaltet von den berühmten Gartenkünstlern Peter Joseph Lenné und Fürst Hermann von Pückler-Muskau, ist dieser Ort ein Geheimtipp für alle, die romantische Natur und historische Architektur mögen.
Schloss Cecilienhof, erbaut im englischen Landhausstil von den Hohenzollern, war 1945 Tagungsort der Potsdamer Konferenz, bei der die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs über die Zukunft Europas entschieden. Heute kann man dort nicht nur die historischen Räume besichtigen, sondern auch malerische Gärten erkunden. Seit 1999 gehört Schloss Cecilienhof zum erweiterten UNESCO-Welterbe.
Nicht nur Schlösser und Parks, sondern auch andere historischen Bauten gehören zum UNESCO-Welterbe. Die Glienicker Brücke, die Potsdam mit Berlin verbindet, diente während des Kalten Krieges als Austauschort zwischen Agenten aus dem Osten und Westen. Heute kann man auf dieser Brücke einen der schönsten Ausblicke auf die Havellandschaft genießen.
- U= Universitätsstadt

Potsdam Universitätsstadt: Akademische Leistungen in einer historischen Umgebung
Potsdam, die malerische Hauptstadt Brandenburgs, ist nicht nur für ihre Schlösser und Gärten bekannt, sondern auch für ihre Hochschulen. Wer hier studiert oder forscht, genießt eine Kombination aus akademischer Exzellenz, kulturellem Reichtum und idyllischer Natur.
Die größte und angesehenste Hochschule der Stadt ist die Universität Potsdam. Mit ihren Standorten in historischen Gebäuden wie dem Neuen Palais und dem Park Sanssouci vereint sie akademische Tradition mit modernster Forschung. Von Rechts- und Geisteswissenschaften bis hin zu Naturwissenschaften bietet die Universität eine breite Auswahl an Studiengängen und unterstütz internationale Forscher:innen.
Die unter Mediendokumentar:innen bekannte Fachhochschule Potsdam bietet praxisorientiertes Studium nicht nur in den Bereichen Informations- und Datenmanagement, Archiv- und Bibliothekswissenschaft, sondern auch Architektur, Design, Bauingenieurwesen und Sozial- und Bildungswissenschaften. Die Hochschule ist bekannt für ihre innovativen Lehrmethoden und enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und kulturellen Einrichtungen.
Ein besonderes Highlight von Potsdam ist die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF - die älteste Filmhochschule Deutschlands. Direkt neben dem Filmpark Babelsberg gelegen, werden hier Nachfolger:innen in den Bereichen Regie, Drehbuch, Schauspiel und Produktion ausgebildet. Die enge Verknüpfung mit der Filmindustrie und preisgekrönte Absolvent*innen sorgen für weltweites Interesse an diese Hochschule.
In Potsdam gibt es nicht nur die Möglichkeit zu lernen, sondern auch die Freizeit zu genießen. Ob man die UNESCO-Weltkulturerbestätten erkundet oder entspannte Stunden am Havelufer verbringt - das Studium wird hier zu einem Erlebnis gemacht. Inspirierende Cafés, Kinos, Theater sowie zahlreiche Festivals tragen zu einem lebendigen Studententreiben bei.
- V=Villenkolonie Neubabelsberg

Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sich hier vor allem wohlhabende Bürger Potsdams und Berliner am Ufer des Griebnitzsees an, um in der Nähe der Hauptstadt zu wohnen und dennoch die Vorzüge einer naturnahen Umgebung genießen zu können.
Die Architektur der Villen in Neubabelsberg ist vielfältig und spiegelt verschiedene Stile wider, darunter Historismus, Neorenaissance und Jugendstil. Viele der prächtigen Gebäude wurden von namhaften Architekten, wie Mies van der Rohe oder Hermann Muthesius, entworfen und zeichnen sich durch ihre individuellen Fassaden, großzügigen Gärten und oft auch durch aufwendige Details aus.
In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ließen sich wegen der Nähe zur Filmstadt Babelsberg auch Filmstars in den Neubabelsberger Villen nieder, unter ihnen Heinz Rühmann, Brigitte Horney und Marika Rökk.
Während der Potsdamer Konferenz 1945 im Schloss Cecilienhof residierten die alliierten Regierungschefs Winston Churchill, Josef Stalin und Harry S. Truman im Viertel. Die Villen, in denen die drei Staatsmänner zu dieser Zeit wohnten, sind noch heute nach ihnen benannt.
Die Villenkolonie Neubabelsberg hat sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten Wohnort entwickelt, der sowohl historische als auch moderne Elemente vereint. Heute ist sie bekannt für ihre ruhige, grüne Umgebung und die hohe Lebensqualität, die sie bietet.
- V=Volkspark

Der Tagungsort der vfm-Tagung 2025 ist umgeben vom Potsdamer Volkspark. Seinen Ursprung hat dieser in der Landesgartenschau 2001, die auf eben diesem Gelände stattfand. Ganz so groß wie zur Gartenschau ist der Park heute nicht mehr, denn an seinen Rändern sind einige Neubaugebiete entstanden. Doch mit 60 Hektar bietet er immer noch genug Platz, um sich auszutoben. Und das kann man im Volkspark nur zu gut, denn es gibt hier eine breite Auswahl an Freizeitaktivitäten zu entdecken. Für Kinder gibt es mehrere Spielplätze, einen davon sogar mit Planschbecken. Jung und Alt können sich auf einem überdachten Basketball-Court, einer Skate-Anlage, beim Beachvolleyball und beim Discgolf sportlich betätigen.
Gerade Discgolf ist sehr zu empfehlen, falls man mal einen neuen Sport ausprobieren will. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine Art Golf mit Frisbee-Scheiben, die an der Parkinformation, gleich neben der Biosphäre, geliehen werden können.
Wer in den Volkspark geht, merkt sofort, dass er sich nicht in einer Metropole wie Berlin oder Hamburg befindet. Ist dort jeder Grünstreifen sofort überfüllt und oft auch vermüllt, sobald die ersten Sonnenstrahlen die Erde treffen und es über 10 Grad warm ist, geht es im Volkspark stets entspannt zu. Wie die meisten Grünanlagen in Potsdam, ist auch der Volkspark sehr gepflegt und sauber, sodass man sich bei einem Spaziergang sofort wohlfühlt. Dafür zahlt man dann auch gerne die 1,50 € Tageseintritt, eine Jahreskarte kostet gerade einmal 19 Euro. Denn der Eintritt sorgt dafür, dass der Park so vorbildlich gepflegt werden kann.
- W=Weberviertel

Das Weberviertel in Potsdam-Babelsberg ist ein charmantes und historisches Viertel, das durch seine einzigartige Architektur und Atmosphäre besticht. Gut erhaltene Weberhäuschen und Straßennamen wie Tuchmacher- oder Garnstraße erinnern auch heute noch an die einstige, auf Wunsch Friedrichs II. errichtete Weberkolonie Nowawes ("Neues Dorf"). Seit 1750 siedelten sich hier böhmische Protestanten aufgrund der versprochenen Religions- und Steuerfreiheit an.
Mittelpunkt der Siedlung war und ist der Weberplatz mit der Friedenskirche. Diese wurde 1752/53 nach Plänen von Johann Boumann errichtet. Der Weberplatz ist an den Wochenenden regelmäßig Schauplatz für Floh- und Bauernmärkte, im Juni für das Böhmische Weberfest und im Dezember Ort des Böhmischen Weihnachtsmarktes.
- W=Weisse Flotte Potsdam

Potsdam an der Havel hellem Strande.
Dass Potsdam eine Wasserstadt ist, lässt sich aus der Luft erfassen, zu Land - pardon zu Wasser - am besten mit der Weissen Flotte Potsdam: Fast Kult-Status hat schon die große Schlösser-Rundfahrt, zweimal im Jahr auch nachts angeboten. So kann man bei Musik und Dinner den Tag ausklingen lassen und dabei die illuminierten Park- und Schlossanlagen Potsdams genießen.
- X= Room X

Escape-Room für Streber: Schulklassen ab Jahrgangsstufe 10 haben hier 60 Minuten Zeit sich durch informatische Kenntnisse aus dem Escape Room zu befreien: hier hilft kein unnützes Wissen, keine auswendig gelernte Geschichtsbücher, nein, hier hilft nur das Wissen über den binären Code und Automatentheorie: selbstredend sind Smartphones und dergleichen nicht erlaubt zur Lösung der Aufgaben.
- Y=Yacht

In Potsdam wohnen so einige Menschen mit zu viel Geld auf ihrem Konto.
Und wer was auf sich hält und seinen Reichtum gerne zeigen möchte und dazu vielleicht auch noch eines der begehrten Seegrundstücke hat, der schippert am Wochenende gerne mal mit der eigenen Yacht über die Gewässer rund um die Stadt. Wer sich zum Beispiel die Villen am Griebnitzsee mal von der Wasserseite anschaut, der erlebt, dass einige sich für ihr Wassergefährt sogar ein eigenes Haus gebaut haben, damit es das Bötchen auch schön warm hat.
Und wer kein eigenes Bootshaus hat, der legt eben in der Marina am Tiefen See, unweit des Hauptbahnhofs, der Neustädter Havelbucht oder im Yachthafen in Potsdam West an.
- Z=ZZF Zentrum für Zeithistorische Forschung

Interdisziplinär wird hier zur deutschen und europäischen Zeitgeschichte geforscht.
Ein weiterer Baustein zum Bildungsstandort Potsdam mit all seinen Forschungsstätten.
Die Forschungsergebnisse werden in Form von Publikationen nach außen getragen, darunter auch die Schriftenreihe Zeithistorische Studien.
Die A-Z Autoren in diesem Jahr sind:
Sabrina Bernhöft (HR), Diana Domesle, Aleksandra Pure, Rosa Bianca Sliwinski, Julia Sommer, Lutz Stöver, Katrin Theile, Alexander Wolff (DRA) und Sara Tazbir (RBB)













